 Das Web 2.0 hat die Protestkultur weiter entwickelt – leichtere Koordinierung, größere Reichweite, mehr Information. Über die Licht- und Schattenseiten des Internet-Protests.
Das Web 2.0 hat die Protestkultur weiter entwickelt – leichtere Koordinierung, größere Reichweite, mehr Information. Über die Licht- und Schattenseiten des Internet-Protests.
Spontan, dezentral, kurzlebig: Proteste im Internet zeichnen sich durch ihre enorme Unberechenbarkeit aus. Zwischen der Protestbereitschaft und der tatsächlichen Teilnahme liegen für den einzelnen meist nur wenige Klicks. Das gilt für den digitalen Mob eines Shitstorms ebenso wie für Anhänger der Anonymous-Bewegung und ihre DDoS-Attacken, bei denen Webseiten-Server von ungeliebten Konzernen oder Organisationen in die Knie gezwungen werden. Immer wieder mahnen Kritiker an, dass derlei Proteste keine langfristigen Effekte erzielen. Irgendwann läuft der Server wieder, irgendwann ebbt jede Erregungswelle wieder ab. Anons und Shitstormer sind zu diesem Zeitpunkt längst unterwegs zum nächsten Ziel.
»Es stimmt: Nachhaltigkeit in der Organisationsstruktur gibt es heute einfach nicht mehr«, sagt Klaus Schönberger. »Man organisiert, versammelt sich und geht dann wieder seiner Wege.« Der Kulturwissenschaftler erforscht an der Zürcher Hochschule der Künste unter anderem Formen und Inhalte des Protests sozialer Bewegungen. Neben der fehlenden Nachhaltigkeit sieht er dabei durchaus auch positive Aspekte. Dem einzelnen Protestwilligen bietet sich etwa die Gelegenheit, punktuell gegen etwas aktiv zu werden, ohne sich gleich einer kompletten Protestsubkultur verschreiben zu müssen, wie das noch bei den 68ern oder den AKW-Gegnern der 80er Jahre der Fall war. »Viele Menschen engagieren sich in erster Linie gegen einen bestimmten Missstand und sind aber mit dem Rest der Gesellschaft sehr einverstanden.«
Für Schönberger stellen Internetproteste in der Hauptsache Weiterentwicklungen bereits bestehender Protestformen dar. Ihre Gründe liegen vornehmlich außerhalb des Internets, in der Offline-Welt. Und nachdem sie sich im Netz formiert und organisiert haben, tragen Aktivisten den Protest zumeist auch dorthin zurück. Mit dem Internet ist Menschen, die sich gegen Zustände in der Welt auflehnen, ein vielfältiges Werkzeug erwachsen, das die Mobilisierung einer interessierten Gruppe schnell und bei Bedarf auch international ermöglicht. In Blogs und auf Webseiten lassen sich ausführliche Informationen verbreiten. Facebook dient der Organisation und Bekanntmachung von Demos. YouTube schafft Kampagnen eine Öffentlichkeit jenseits der Massenmedien. Via Twitter werden Kundgebungen oder deren Blockaden in Echtzeit koordiniert. Gerade in Bezug auf Geschwindigkeit und Reichweite können althergebrachte Medien wie Flugblätter da nicht mithalten. Das Erstellen einer Online-Petition erspart nicht nur einen anstrengenden Samstag in der Fußgängerzone. Zumeist bringt die digitale Sammlung auch mehr Unterschriften zusammen als ihr analoges Pendant.
Trotz aller Erleichterung gerät die Übertragung eines Protests in die Offline-Welt aber nicht immer zum Selbstläufer. Während, beispielsweise, das Handelsabkommen ACTA Anfang 2012 dank massiver Proteste verhindert werden konnte, blieb der Sturm gegen den Gesetzesentwurf zum Leistungsschutzrecht ein Jahr später ein eher laues Lüftchen. Zu lau, um von der Politik wahr- oder ernstgenommen zu werden. Und das, obwohl beide Proteste thematisch recht ähnlich angesiedelt waren. Klaus Schönberger: »Es gibt Protestthemen, die offensichtlich sehr gut bei Facebook funktionieren, bei denen aber im realen Leben die Leute nicht entsprechend motiviert sind, sich zu beteiligen.« In der Zeit vor dem Internet gaben Menschen Unterschriften, lasen Flugblätter und gingen trotzdem nicht zur Demo. Heute ist manchem der Weg vom »gefällt mir« auf die Straße zu weit. Auch dieser Auswuchs ist demnach eine Weiterentwicklung der Protestkultur.


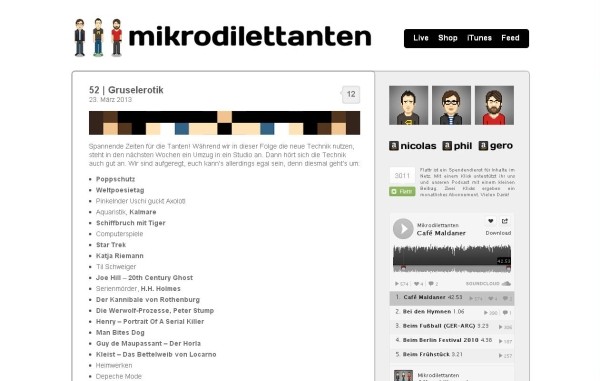
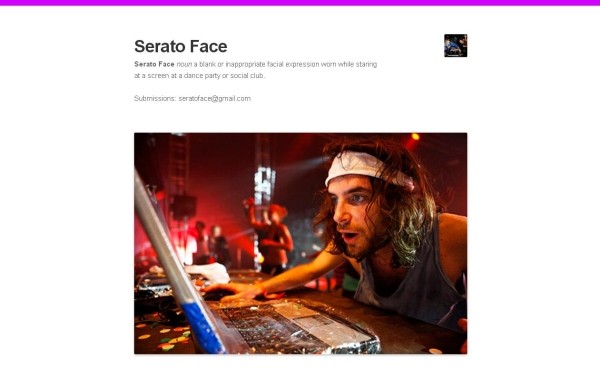


WIe bereits richtig beschrieben, ist es für Menschen sehr leicht geworden, ihren Protest oder Unmut koordiniert gegen eine Sache zu richten.
Ich erinnere mich vor allem bei den Shitstorms an einige bedenkenswerte Aktionen der Netzcommunity. Einmal gabs da den Shitstorm gegen Z‑Promi Georgina Fleur, die zur Zeit des Hochwassers in Heidelberg fesch vor Sandsäcken posierte und das Foto bei Twitter postete. Sie wurde dann von Menschen aufs unflätigste beschimpft, wie sie nur so geschmacklos sein könne, etc. Vollkommen übertrieben, vor allem angesichts der Tatsache, dass in Heidelberg nur einige Keller voll Wasser gelaufen waren.
Dann gab es da einen Aufruf zur Selbstjustiz im Falle des toten Mädchens Lena in Emden. Ein Mob aufgebrachter Menschen wollte einen zu dem Zeitpunkt verdächtigen jungen Mann mit Steinen bewerfen. Hinterher stellte sich der Verdächtige als unschuldig heraus.
Die Social-Media-Kultur hat eben auch eine negative Seite;)
Die Beispiele, die Du nennst, sind natürlich Katastrophen. Tatsächlich schwebten mir solche Sachen bei dem Text gar nicht einmal so sehr vor. Weil das eher Weiterentwicklungen des Prinzips Lynchmob – damals mit Heugabel und Fackel, heute mit Tastatur und Schaum vor dem Mund – sind. Das hat für mich mit Protest im eigentlichen, oder zumindest im guten Sinne nichts zu tun.